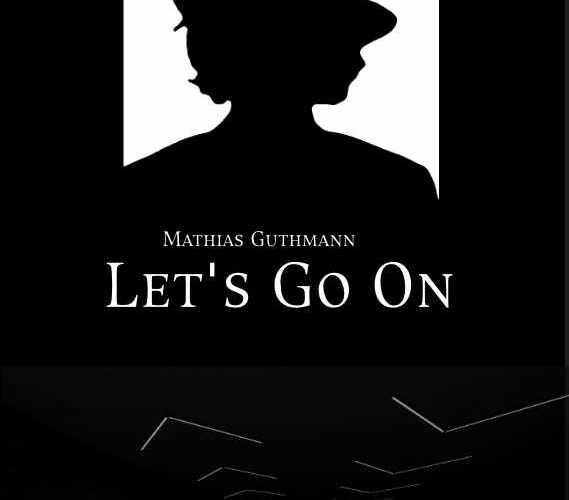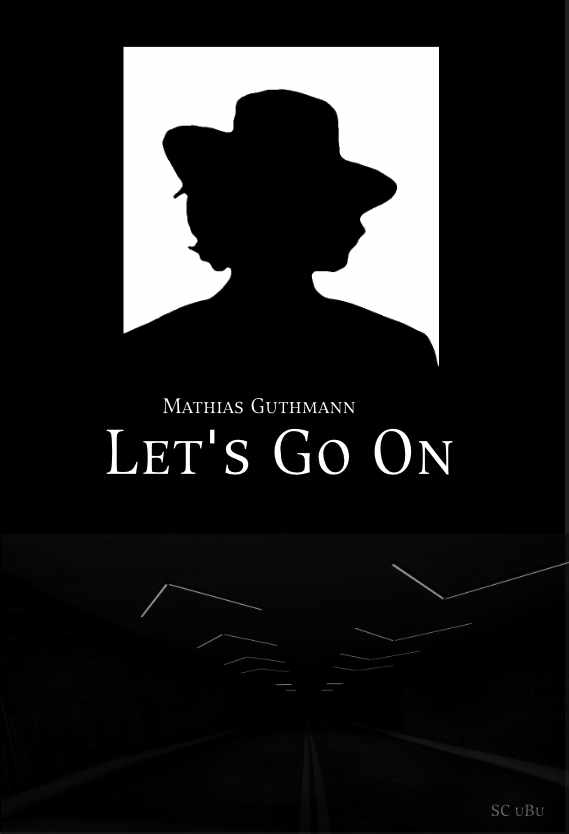
Fortsetzungsroman
Kapitel I
Japanese Corona
Es ist die Zeit von Corona, oder Covid 19 oder wie sonst auch. Die Nachrichten sind voll davon, Sondersendungen rund um die Uhr.
Ich habe nichts zu tun und höre Bill Evans, You Must Believe in Spring. Programmmusik, Frühlingsjazz, perfekte Technik, der Rhythmus bewegt sich auf der Welle, geht in den Kopf. Mit Musik kann man die Zeit anhalten. Die rechte Hand streichelt sphärische Akkorde in den Raum, der Bass klingt trocken. Ein ausgezeichneter Percussionist spielt seine eigene Stimme, ein gutes Arrangement.
Mir fällt ein Dialog in der Bahn ein. Vor mir sitzt jemand, der nervös zwischen den Sitzen wechselt, nach rechts, dann wieder nach links und wieder nach rechts, dabei schreibt er mit seinem Finger Wörter in die Luft.
Laut:„Hallo, können sie mir sagen, wie spät es ist“?
Er blickt er auf einen großen Mann, der eine Jacke trägt, die ihn als Mitarbeiter der Bahngesellschaft ausweist.
Leise: „Ich habe leider keine Uhr dabei“.
Laut: „Ich muss wissen, wann diese Bahn an der Endstation ankommt, ich habe da einen wichtigen Termin“.
Hilfsbereit: “Habe leider keine Uhr“.
Laut: „Warum? Ich frage nur freundlich nach der Zeit nach, ich habe einen wichtigen Termin“.
Freundlich-distanziert: „Wie kann ich ihnen helfen“.
Laut: „Ich habe einen wichtigen Termin bei der Kriminalpolizei, ich bin ein stolzer Sizilianer“.
Hilfsbereit: „Wohin nochmal“?
Laut:“Zur Endstation, immer das gleiche hier, man wird verarscht, so ist es in Deutschland, ich will doch nur wissen ob ich meinen Termin noch bekomme um 14:00 Uhr“.
Es ist schon fast drei Uhr mittags. Ich stelle eine allgemeine psychosomatische Störung fest. Man verabschiedet sich freundlich.
Man sagt, dass diese Krise die schlimmste nach dem 2.Weltkrieg wäre.
Ich erinnere mich ein ein Treffen mit dem japanischen Kaiser, in einer Bar in Tokio. Nach einigen Whiskys sprechen wir über die Unterschiede zwischen Europa und Japan, eine zierliche Dolmetscherin macht das möglich. Akihito ist gut drauf.
„Wir haben keine Atombomben mehr“.
„Die hattet ihr noch nie“.
Akihito lächelt weise und sagt dann:
„Vielleicht“.
„Gibt es noch Whisky“?
Akihito: „Ja gerne, ich frage nach“.
Ich betrachte seine Frau. Schlaffe Brüste, aufgeklebte Wimpern, einen Gang wie ein lahmer Leopard.
Akihito: „Ich schicke sie weg“.
Ich: „Danke“.
Akihito:“In Zukunft wird mein Sohn den Laden schmeißen, haben Sie etwas dagegen, wenn ich Pink Floyd, Dark Side of the Moon auflege“?
Ich: „Wenn ihre Frau nichts dagegen hat, gerne“.
Akihito: „Die geht jetzt ins Bett“.
Ich: „Super.“
Akihito: „Ich liebe meine Frau, sie ist die Zierde meines Lebens sie ist mein Elixier“.
Ich: „Leck mich“.
Akihito: „Ich weiß wie unkultiviert Europa ist“.
„Wo bleibt der Whisky“?
Akihito:“Frage ich mich auch“.
Akihito: „ Als sie damals das Interview mit Marlon Brando geführt haben, hat er etwas über Sex erzählt“?
Ich: „Ja, absolut, es ging um Penetration“.
Ich verlasse das Lokal, höre dabei Pink Floyd. Die Straßen in Tokyo sind belebt, an einer Ecke bietet mir ein Typ mit einer überdimensionalen Sonnenbrille gebrauchte Damenhöschen an, ich überlege kurz und lehne dann ab, der Preis stimmt nicht.
Bevor Sie weiterlesen ein paar Zeilen zur Erklärung: Jeder Autor will einfache und wahre Geschichten erzählen, wahre Begebenheiten sind aber oft langweilig. Nur ab und zu findet sich im Leben eine Geschichte mit einem poetischen Kern. Autoren sind wie Trüffelschweine, anstatt grunzend nach wertvollen Pilzen unter der Erde zu graben, suchen sie aber nach Ideen, daraus werden dann Geschichten geformt, die sich traurig, tragisch, komisch oder überhaupt ganz anders lesen.
Mit diesem Text will ich Sie lediglich unterhalten, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Japan ist schön und skurril und beides gleichzeitig. Die Menschen leben auf engstem Raum und sind außer ihren Frauen noch mit ihrer Arbeit verheiratet, ein ungünstiges Schicksal.
Abends geht man mit den Kollegen in die Bar, um dort seine Verbundenheit mit der Firma zu feiern, Gesellschaftskapitalismus der humorlosen Art, jedenfalls aus meiner Sicht.
Wenn Sie in Tokio unterwegs sind, tauchen manchmal unvermittelt bunte Maskottchen auf und tanzen zu albernen Choreografien. Ebenso schnell wie sie gekommen sind, verschwinden sie gleich wieder im nächsten großen Kaufhaus. Es gibt sogenannte Yuru-Chara-Festivals, dort treffen sich gleichgesinnte Maskottchen in großer Menge, um gemeinsam zu feiern und vielleicht auch, um Damenhöschen zu tauschen.
Ich reise nach Kyoto, man hat mich dort für einen Umami-Kurs engagiert.
Eine schöne Stadt, besonders im April, es ist die Zeit der Kirschblüte. Überall finden Hanamis statt, man feiert mit Freunden und Familie in den Parks, zuhause, oder draußen in der Natur, der Sake fließt in Strömen. Zu diesem Fest lässt man in Japan fünf auch mal gerade sein.
Nach der Ankunft habe ich noch Zeit für einen kleinen touristischen Abstecher. Beim ersten Licht fährt mich ein Taxi zum Kinkaku-ji. Ich freue mich auf diese Ablenkung, mindestens genauso, wie auf das schöne Honorar für den Kurs.
Mit Kursen halte ich mich über Wasser, mit Reden für Firmenjubiläen und Trauerfeiern, mit Kritiken und Kurzgeschichten. Manchmal landet das Honorar sogar auf dem Konto, wir Lohnschreiber stehen ganz unten in der Nahrungskette.
„Wir würden Sie gerne für diesen Text haben, unser Budget gibt leider aber nicht viel her“. Diesen Satz höre ich fast immer, wenn ich gebeten werde, etwas zu einem bestimmten Thema zu schreiben, man gewöhnt sich daran, ich jammere nicht, jammern ist erbärmlich. Ironie ist besser. Ironisches Jammern am besten.
Kinkaku-ji ist mit Gold überzogen, der Tempel glüht förmlich im morgendlichen Sonnenlicht. Direkt davor gibt es einen kleinen See, der das Gebäude sanft lächelnd widerspiegelt. Ein schönes Gemälde.
Nur wenige Touristen sind um diese Zeit unterwegs. Ich beobachte eine schlanke, elegant gekleidete Frau, die unablässig fotografiert und dabei schrille, helle Entzückensschreie ausstößt. Wie wird sie sich wohl in anderen Situationen artikulieren? Ein interessanter Gedanke, der mich auf der Fahrt ins Hotel begleitet.
Bevor ich das Zimmer betrete, bittet man mich freundlich darum, die Schuhe auszuziehen. Aus dem Fenster sieht man den Kyoto Tower. Außer dem großen Futonbett aus Zedern-Holz ist das Zimmer unmöbliert. Vor dem geräumigen Apartment gibt es einen kleinen, von einer Schiebetüre abgetrennten Raum für das Gepäck.
Die Wände sind mit kunstvollen Tapeten bezogen, darauf sind fliegende Kraniche und Kirschblüten abgebildet. Hinter einer weiteren Schiebetüre befindet sich die vollautomatisierte Toilette, während der Benutzung kann man aus einer Playlist die gewünschte Beschallung auswählen.
Ich schwanke zwischen Yellow Submarine, Forellenquintett und Ballade pour Adeline, entscheide mich schließlich für Anarchy in the UK von den Sexpistols.
Right now ha, ha, ha, ha, ha
I am an anti-Christ
I am an anarchist
Don’t know what I want
But I know how to get it
I want to destroy the passerby…
…I want to be anarchy
And I want to be anarchy
(Oh what a name)
And I want to be an anarchist
(I get pissed, destroy!)
Ich notiere letzte Gedanken für den Kurs am nächsten Tag: Keine Maskottchen, keine Schulmädchen, kein Harakiri.
Das Handy klingelt. Präfekt Tanaka lädt mich zum Lunch in den Tempel ein, eine Überraschung, vielleicht hat er Wind von meinem Treffen mit dem Tenno bekommen und will sein Gesicht nicht verlieren.
Tanaka ist ein kultivierter Mann und pflegt einen luxuriösen Lebensstil. Man spricht von einem sagenhaften Vermögen. In Monaco liegt seine riesige Yacht, die „Mogambo“ vor Anker. Das Schiff hat er günstig von einem afrikanischen Potentaten erworben, der beim Volk in Ungnade fiel und der nun in Saudi-Arabien sein Luxus-Exil genießt, allerdings ohne die „Mogambo“, ohne seinen Harem mit 140 Frauen und ohne die zwei Tonnen Diamanten, die er seinem Land geraubt hat, dafür ist ihm sein Kopf geblieben, Glück gehabt.
Die Yacht ist 160 Meter lang, verfügt über mehrere Liegewiesen, Whirlpools und natürlich über einen Hubschrauberlandeplatz, sie bietet Platz für 100 Gäste, es darf gefeiert werden.
In den Medien taucht Tanakas Name immer wieder im Zusammenhang mit den Yakuza auf. An dem Teflon-Politiker perlen diese Gerüchte jedoch wie der Morgentau auf einem Lotusblatt bei Sonnenaufgang ab.
Ich rasiere mich vor einem Spiegel mit zehnfacher Vergrößerung. Der Effekt ist beängstigend. Gesichtshaare verwandeln sich in einen mächtigen Urwald, kleine Pickel werden zu Vulkanen aus denen lautlos graue Asche steigt, rote Flecken sehen aus wie kochende Lava-Seen, Falten sind tiefe, schattenwerfende, trostlose Schluchten. Altersflecken mutieren zu dunklen, toten Meeren. Das Gelände wird schnell eingeschäumt und durchpflügt, bis alles glatt ist. Erleichtert wende ich mich vom traurigen Schauspiel ab.
Der blaue Anzug aus Italien ist von der Reise gezeichnet, ich bürste ihn sorgfältig und ziehe dabei die Knitterfalten, so gut es geht, glatt. Auch das helle Canali-Hemd hat gelitten, hastig bügle ich das gröbste weg. Die blau-weiße Niki Milano Krawatte wird mit einem einfachen Knoten umgebunden, das wirkt lässig. Wie der Laufbursche des Tennos sehe ich nicht aus, beruhigend! Ich muss kurz lachen, als ich mich an meine Jugend erinnere und an das, was ich damals trug, die Zeiten ändern sich. Zuletzt setze ich den Panama mit breiter Krempe auf den Kopf und klemme mir die Ray-Ban Wayfarer hinter die Ohren.
Auf der Strasse steigt plötzlich ein Schwarm kohlschwarzer Schwalben über uns auf und tanzt ein Ballett in den Himmel. Eine kleine Menschenmenge beobachtet gebannt das Spektakel. Die riesige Schwalben-Kunstflugstaffel jagt Häuserwände hoch und wieder runter, ändert unvermittelt die Richtung, steigt senkrecht in die Höhe um sich sogleich mit atemberaubender Geschwindigkeit in die Tiefe zu stürzen, ganz nah an uns vorbei, man spürt den Luftzug im Gesicht. Kurz vor dem Aufprall auf den Boden wird ein Looping gedreht, dann fliegt das Geschwader, wie auf Kommando, pfeilschnell die Straße entlang und verschwindet in der Ferne. Es gibt Applaus und die Menschen gehen lachend auseinander. Schwerkraft ist relativ.
Lesen Sie in der nächsten Folge: Empfang bei Tanaka, eine Autofahrt.
![[:de]Grandgourmand, Travel, Food, Lifestyle[:]](https://grandgourmand.de/wp-content/uploads/2023/01/logo_23_1-1.png)